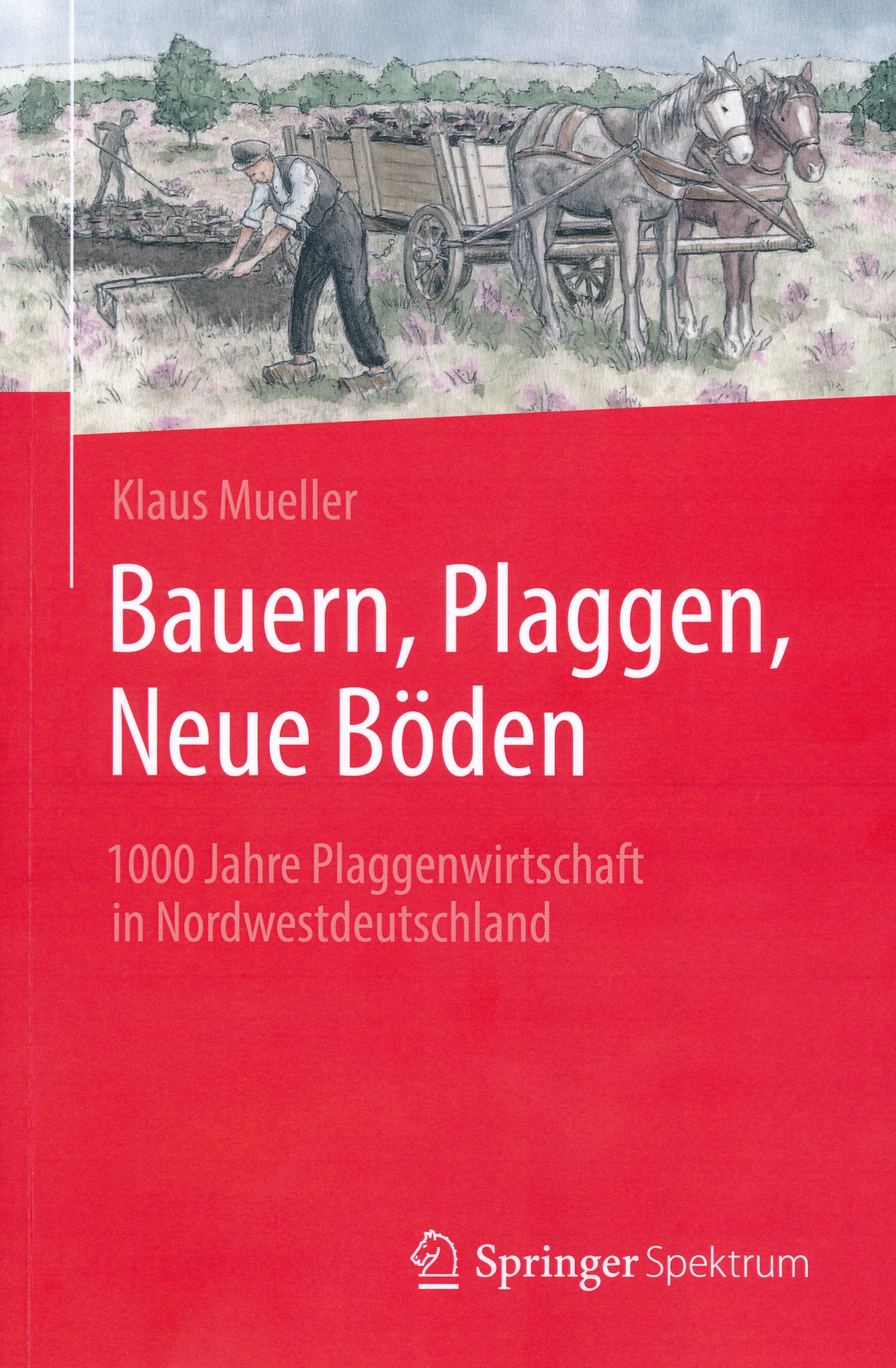
Inhalt
Die Plaggenwirtschaft war eine über 1000 Jahre praktizierte Form der Landwirtschaft, die den gesamten nordwestdeutschen Raum in einzigartiger Weise geprägt hat. Zeugnisse dieser Landnutzung wie fruchtbare Böden, Eschkanten und ausgedehnte Heidegebiete, lassen sich bis heute in der Landschaft finden. Neben der landwirtschaftlichen Entwicklung, Bodennutzung und typischen Landschaftsformen beeinflusste sie auch ganz wesentlich das Fühlen, Denken, Handeln und Zusammenleben der Menschen dieser Zeit. Aber wer weiß heute noch etwas darüber? Das Buch gibt hierauf spannende und interessante Antworten. Vorgelegt wird eine erste allgemein verständliche Übersicht zu allen Aspekten der Plaggenwirtschaft in Nordwestdeutschland. Angesprochen werden nicht nur Landwirte, Bodenkundler, Geographen und Archäologen, sondern vor allem auch Leser, die Interesse an der bäuerlich geprägten Vergangenheit der Menschen und deren sozio-kulturelle Prägung in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Teilen Mecklenburgs haben.
ISBN-Nr.: 978-3-662-68914-1, 253 Seiten, 276 Abbildungen
Autor
Prof. Dr. Klaus Mueller hat nach einer landwirtschaftlichen Lehre Agrarwissenschaften studiert und auf dem Gebiet der Bodenkunde promoviert. Er war bis 2020 als Professor für Bodenkunde und Geologie an der Hochschule Osnabrück in der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur tätig. Viele Jahre beschäftigte er sich vor allem mit der Verbreitung von Böden, ihrer Systematik, Nutzung und ihrem Schutz in Deutschland und der Welt. Er war maßgeblich am Aufbau des ersten Studiengangs "Bodenwissenschaften" in Deutschland beteiligt und als Vizepräsident der „Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft“ sowie im Vorstand des „Bundesverband Boden“ aktiv. Seit seiner Emeritierung gilt sein besonderes Interesse der Plaggenwirtschaft und ihren Auswirkungen auf Landschaften, Böden und der bäuerlichen Entwicklung in Nordwestdeutschland.
Vorwort
Im 10. bis 14. Jahrhundert kam es in Mitteleuropa zu einer deutlichen Zunahme der Bevölkerung, deren Ernährung mit den bisherigen Abläufen in der Land-
wirtschaft nicht mehr sicherzustellen war. Vor allem wurden neue, innovative Methoden des Ackerbaus notwendig. In weiten Teilen Europas setzte sich die
Dreifelderwirtschaft durch. Die meist sandigen und wenig fruchtbaren Böden in der Nordwestdeutschen Tiefebene und in den östlichen Teilen der Niederlande
waren dafür allerdings wenig geeignet. Hier entwickelte sich ein einzigartiges Verfahren der Landnutzung, das in Ablauf und Ausdehnung weltweit nur in diesem
Raum praktiziert wurde: die Plaggenwirtschaft.
Bei dieser Form der landwirtschaftlichen Bodennutzung wurden auf nassen Wiesen, Heideflächen und in Wäldern Plaggen (Grassoden mit anhaftendem Erd-
reich) gestochen, in die Viehställe gebracht, dort als Einstreu verwendet und meist kompostiert. Anschließend wurden mit dem Material die Felder gedüngt. Das erlaubte eine dauerhafte Nutzung der Äcker und führte zum „ewigen Roggenbau“.
Die Plaggenwirtschaft war mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden, wie dies heute kaum noch bekannt und vorstellbar ist. Das gesamte tägliche Leben
auf den Höfen wurde durch diese Wirtschaftsform bestimmt. Ganze Landschaften wurden umgestaltet und verändert. Noch heute sind aufgehöhte Eschflächen, tiefer
gelegte Entnahmebereiche und Eschkanten sichtbar. Selbst ein neuer Bodentyp mit einer deutlich erhöhten Bodenfruchtbarkeit entstand – der Plaggenesch. Anderer-
seits verödeten ganze Landschaften. Die heute in Nordwestdeutschland zu finden-den ausgedehnten Heideflächen und mittelalterlichen Sanddünenlandschaften sind
größtenteils eine Folge der Plaggenwirtschaft.
Unbestritten hatte die Plaggenwirtschaft auch soziokulturelle Auswirkungen. Flur- und Straßenbezeichnungen mit „Esch“ sind in Nordwestdeutschland weit
verbreitet. Familiennamen wie Esch, Escher, Plagge oder Placke sind häufig zu finden. Auch Sprache, Sitten, Gebräuche und Erzählungen wurden durch die
Plaggenwirtschaft geprägt. Umso erstaunlicher ist es, wie wenig heute in der Bevölkerung, nur 100 Jahre nach Beendigung der Plaggenwirtschaft, über diese, ganz Nordwestdeutschland prägende Form der Bodennutzung bekannt ist. Andererseits besteht großes Interesse an der Geschichte und den Leistungen der Vorfahren, vor allem, wenn eine tiefere Verwurzelung zur engeren Heimat und zur bäuerlich geprägten Vergangenheit gegeben ist.
Das Anliegen des Buches ist es, diese Informationslücke zu schließen. Auf der Basis eigener umfangreicher Forschungsarbeiten, Studien und ausgewerteter Lite-
ratur wird über die Plaggenwirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft, auf Böden, auf Landschaften und auf die Menschen berichtet. Zielgruppe
sind nicht in erster Linie Fachleute, sondern die interessierte Öffentlichkeit, für die keine umfassende populärwissenschaftliche Darstellung über diese Form der his-
torischen Landnutzung vorliegt. Das Buch ist nicht nur als Informationsquelle für breite Kreise der Bevölkerung gedacht, sondern auch für den Einsatz in Schulen,
Hochschulen und in der Bildungsarbeit geeignet. Didaktisches Prinzip sind relativ kompakt gehaltene, verständlich formulierte Texte, viele Beispiele aus dem Ver-
breitungsgebiet der Plaggenwirtschaft in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sowie eine Fülle historischer und aktueller Abbildungen. Ver-
tiefende Ergänzungen im Text tragen zu einem besseren Verständnis relevanter Zusammenhänge bei. Der weiteren Information dient ein umfangreiches Literaturver-
zeichnis.
Dieses Buch entstand in ständigem Austausch mit Freundinnen und Freunden, Fachkolleginnen und Fachkollegen, Angehörigen und Unterstützern. Ihnen allen möchte ich meinen herzlichen Dank ausdrücken.
Zu nennen sind insbesondere Lutz Makowsky für seine außerordentlich fachkundige Durchsicht des Manuskriptes und Bodo Zehm, der mich mit Rat und
Tat unterstützte und dem ich viele wertvolle Hinweise zu archäologischen Fragestellungen verdanke. Gertrud Große-Heckmann sowie Yvonne Kniese und Chris-
tian Dahlhaus halfen mir sehr bei der Erarbeitung der Abbildungen. Technische Hilfe gaben Ernst Schützler und vor allem Veit Mueller. Mein besonderer Dank
gilt meiner Enkeltochter Juna Günther, die (mit etwas Unterstützung durch ihre Mutter) mit großem Eifer ein Kapitel mit ihren Bildern bereicherte.
Die Vorbereitungen für das Buch begannen bereits vor etlichen Jahren. Dazu gehören umfangreiche Laboruntersuchungen der beschriebenen Böden, die Elke Nagel sehr zuverlässig durchführte. Kathrin Böhme trug durch fleißige Literaturrecherchen zur Materialsammlung bei. Zu großem Dank verpflichtet bin ich auch vielen Landwirten und Heimatvereinen im Osnabrücker- und im Münsterland, die teils umfangreiche Auskünfte gaben und Material zur Verfügung stellten.
Die Arbeit der Lektorin Grit Zacharias zeichnete sich nicht nur durch eine sorgfältige Durchsicht des Manuskriptes, sondern auch durch hohen bodenkund-
lichen Sachverstand aus. Dem Springer-Verlag (insbesondere Frau Bettina Saglio und Herrn Simon Shah-Rohlfs) danke ich für die konstruktive und hilfreiche Zu-
sammenarbeit.
Ganz besonderer Dank gilt meiner Frau, die meine jahrelange Beschäftigung mit der Plaggenwirtschaft verständnisvoll begleitete und mich insbesondere durch
ihr außerordentlich gründliches Korrekturlesen vor manchem Schreib- und Ausdrucksfehler bewahrte.
Klaus Mueller
Inhaltsverzeichnis
1 Was vorher war . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 1
1.1 Jäger, Sammler und Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .... . . 1
1.2 Kupfer, Bronze und Eisen . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 6
1.3 Römer und wandernde Völker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . 9
1.4 Rückbesiedlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . 11
1.5 Der Esch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . 16
1.6 Die Allmende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . 16
2 Nahrung braucht das Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 23
2.1 Rasche Bevölkerungszunahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 23
2.2 Zwei Wege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 28
2.3 Auf Sand (an)gebaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 31
2.4 Lösung des Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .... . 36
3 Harte Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . 39
3.1 Beginn der Plaggenwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 39
3.2 Plaggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 45
3.3 Hauen, Stechen, Schlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 48
3.4 Vom Feld in den Stall und zurück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . 56
3.5 Viel Arbeit … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . 62
3.6 Zank und Streit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ..... . . 64
4 Grenzverläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ..... . 67
5 Neuer Boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . . 71
5.1 Ein neuer Bodentyp entsteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ...... . 71
5.2 Veränderte Bodeneigenschaften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . 80
5.3 Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . 85
5.4 Niveauerhöhungen und -ausgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 89
5.5 Niveautieferlegung und Eschkanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 91
5.6 Eschgräben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . 97
6 Neue Landschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 107
6.1 Eschdörfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 107
6.2 Verheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 110
6.3 Wehsandgebiete und Dünen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... . 114
6.4 Ausmaß der Verwüstungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ....... .121
6.5 Zeitzeugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 125
6.6 Bewegter Boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . 128
7 Neue Ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 131
7.1 Markteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... . 131
7.2 Nutzungswandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 137
7.3 Ende der Plaggenwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 144
8 Plaggenesche heute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 151
8.1 Fruchtbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 151
8.2 Klimawandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 155
8.3 Veränderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 162
8.4 Flächenverbrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 165
8.5 Bodenschutzgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. 169
8.6 Schutz archäologischer Befunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . 170
9 Soziokulturelles Erbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 179
9.1 Sprache und Familiennamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . 180
9.2 Landschafts-, Straßen- und Ortsbezeichnungen . . . . . . . . . . .... ...... 186
9.3 Regeln, Sitten und Symbole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . 190
9.4 Sagen, Lieder und Geschichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . 195
10 Ein Tag im Leben eines Hofknechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 199
11 Information tut Not. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 207
11.1 Informationszentrum „Plaggenesch“ Wallenhorst
(Niedersachsen, Landkreis Osnabrück) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 210
11.2 Museumsdorf Hösseringen (Niedersachsen, Kreis Uelzen) . . ...... . 215
11.3 Wacholderhain Merzen-Plaggenschale (Niedersachsen,
Landkreis Osnabrück) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 218
11.4 Bodenlernstandort Plaggenwirtschaft Lotte-Büren
(Nordrhein-Westfalen, Kreis Steinfurt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 222
11.5 Bodenlernstandort Lienen-Kattenvenne (Nordrhein-Westfalen,
Kreis Steinfurt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 225
11.6 Bodenlernstandort Ochtrup (Nordrhein-Westfalen,
Kreis Steinfurt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 227
11.7 Goting Kliff auf Föhr (Schleswig–Holstein, Kreis
Nordfriesland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............230
Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . ...... . . 235
Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. 243
Rezensent: Bodo Zehm (Archäologe)
Klaus Mueller:
Bauern, Plaggen, Neue Böden
1000 Jahre Plaggenwirtschaft in Nordwestdeutschland
Springer-Verlag GmbH 2024
ISBN-Nr.: 978-3-662-68914-1, 253 Seiten, 276 Abbildungen, 37,99 €
Schon bei der ersten Durchsicht hat man das Gefühl, mit diesem Buch des Bodenwissenschaftlers Prof. Dr. Klaus Mueller etwas besonders Wertvolles in der Hand zu halten, und es gibt viele gute Gründe, warum das für dieses kurz nach Weihnachten 2024 erschienene Buch gilt. Der Untertitel „1000 Jahre Plaggenwirtschaft in Norddeutschland“ deutet bereits an, dass hier ein Kernthema der deutschen Agrargeschichte behandelt wird. Es geht um den Plaggenesch, einem vor allem in Nordwestdeutschland weiträumig verbreiteten Ackerboden, der seine Entstehung, seine bodenkundlichen Merkmale und seine bis heute wahrnehmbare landschaftsprägende Bedeutung einem seit dem Mittelalter gleichbleibend praktizierten, aufwändigen Arbeitsverfahren verdankt. Dabei wurden humusreiche Erdplaggen, die von ackerbaulich ungünstigen Standorten stammen, zu Lagerplätzen im Nahbereich der bäuerlichen Siedlungen transportiert, dort mit Tierdung, Küchenabfällen, Stalleinstreu u. ä. angereichert und periodisch, im Einklang mit den landwirtschaftlichen Produktionszyklen, in großen Mengen auf die Anbauflächen verbracht - was nicht nur ein gutes Düngeverfahren für den früher hier üblichen „ewigen Roggenanbau“ war, sondern zu einem bis heute ungewöhnlichen und besonders wertvollen Bodentyp führte.
Obwohl diese Agrartechnik über viele Jahrhunderte hinweg von maßgeblicher Bedeutung für das Leben und Überleben der bäuerlichen Bevölkerung war und noch bis vor 100 Jahren den markanten Rahmen für das mühsame, tägliche Einerlei des „sich Plagens“ bildete, ist seine umfassende Bedeutung selbst im ländlichen Raum heute kaum noch bekannt. Für den Verfasser, der bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2020 27 Jahre lang an der Hochschule Osnabrück an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur gelehrt hat und dort für den Bereich Allgemeine Bodenkunde und Geologie zuständig war, dürfte diese Lücke im allgemeinen kollektiven Gedächtnis ein besonderer Ansporn gewesen sein, das Thema besonders wirkungsvoll in Erinnerung zu bringen - nicht zuletzt dadurch, dass er es umfassend, gut verständlich und anschaulich darstellt. Und das ist ihm überaus gut gelungen! So entstand rund um die bodenkundlichen Aspekte herum ein herausragendes Fachbuch, bei dem es sich um nichts weniger als um ein Grundlagenwerk zur Geschichte der Landwirtschaft handelt und das darüber hinaus allein schon deswegen einzigartig ist, weil es wohl niemals zuvor jemandem gelungen war, ein bodenkundliches Thema mit einer derartigen Fülle an authentischen Einblicken in den vielgestaltigen Bereich der bäuerlichen Alltagskultur zu verbinden. Ausgangspunkt der Zusammenschau ist die Beschreibung der historischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden allgemeinen Anforderungen an die landwirtschaftliche Produktion ab der Jungsteinzeit. Ausführlich werden an späterer Stelle unter den Überschriften „Neue Landschaften“ und „Neue Ordnung“ die mittelalterlichen und die frühneuzeitlichen Verhältnisse behandelt. Im Anschluss an die historische Betrachtung folgt eine Beschreibung der aktuellen Situation, dabei unter „Flächenverbrauch“ ein kritischer Blick auf die heute übliche Freiraumplanung und Bodeneingriffe, die zum Verlust großer Bereiche dieser Plaggenesche führen, sowie die Auswirkungen einer derart rigorosen Vorgehensweise auf Klima und Umwelt.
Mueller gelingt es, fachlich kompetent, eindrücklich, aber ohne Pathos, mit zahlreichen Bildern, Textdokumenten und vor allem in klaren Worten, die Geschichte, die fachspezifischen Merkmale und den Wert dieses „Kultosols“ (lat.: cultus = gepflegt, bearbeitet; solum = obere Bodenschicht) sowohl aus bodenkundlicher Sicht hervorzuheben wie auch aus emischer Perspektive wieder lebendig werden zu lassen. Die zahlreichen von ihm verwendeten historischen Text- und Bilddokumente bis hin zur Beschreibung des heutigen, mit dem Plaggenesch verbundenen soziokulturellen Erbes zeigen die tiefe Verwurzelung dieser fast in Vergessenheit geratenen Seite des Ackerbaus in der Geschichte der bäuerlichen Lebenswelt im Großraum Weser-Ems seit mehr als 1.000 Jahren. Nicht fehlen schließlich Hinweise auf öffentlich zugängliche, mit dem Thema verbundene Informationsstandorte wie z.B. dem Wallenhorster „Informationszentrum Plaggenesch“ im Osnabrücker Land, das Museumsdorf Hösseringen und einige „Bodenlernstandorte“ in Niedersachsen und im nordwestlichen Nordrhein-Westfalen.
In der Antike wurde der hohen Bedeutung des Bodens Respekt gezollt, indem er gemeinsam mit Feuer, Wasser und Luft als Grundelement des Lebens gewürdigt wurde. Warum es auch in heutiger Zeit notwendig ist, eine vergleichbare Wertschätzung beizubehalten, wird im Buch von Klaus Mueller schon dann deutlich, wenn die Leser sich einen ersten Eindruck von der Komplexität und inhaltlichen Tiefe des Themas verschafft haben. Darüber hinaus bietet es einen lebendigen, unverfälschten Einblick in 1.000 Jahre Alltagsgeschichte auf dem Lande. Bleibt zu hoffen, dass viele an Natur, Kultur und Landschaftsgeschichte Interessierte von der Möglichkeit Gebrauch machen, dieses Buch zur Hand zu nehmen.
Bodo Zehm
Rezensentin: Prof. Dr. Gabriele Broll

Klaus Mueller (2024):
Bauern, Plaggen, Neue Böden.
1000 Jahre Plaggenwirtschaft in Nordwestdeutschland, Springer Spektrum Berlin, 253 S.
Eine Buchbesprechung über einen Bodentyp, der zudem nur regional vorkommt, in einem Newsletter des Europäischen Bodenbündnis, in dem Städte und Gemeinden Mitglied sind mit dem Ziel die aktuelle Situation des Bodenschutzes in ihrer Region zu verbessern? Ist das sinnvoll? Ja, denn die heutige Situation vor Ort hat sehr viel mit dem vor Hunderten von Jahren durch den Menschen entstandenen Plaggenesch zu tun.
Zuerst ein kurzer Überblick über das von Klaus Mueller, ehemals Professor für Bodenkunde an der Hochschule Osnabrück, verfasste Buch, das sowohl bei Laien als auch bei Fachleuten bereits auf großes Interesse gestoßen ist. Es ist leicht verständlich lesbar, anschaulich illustriert und zeigt die große Erfahrung und akribische Recherche des Autors, dessen Ziel es war, die Auswirkungen der Plaggenwirtschaft auf die Landschaft und deren Bewohner darzustellen. Die Menschen in Nordwestdeutschland haben damals sehr stark in die Landschaft eingegriffen, indem sie Plaggen aus dem Oberboden an einem Ort mit relativ viel Humus wie Wiesen ausgestochen haben. Diese haben sie in ihren Ställen durch das Vieh düngen lassen und anschließend auf nahegelegenen, nährstoffarmen Flächen ausgebracht. Diese wurde somit mit Humus und Nährstoffen angereichert und konnten dann als Acker genutzt werden. Der Ursprungsort der Plaggen verarmte jedoch an Nährstoffen. Diese Plaggenwirtschaft war natürlich räumlich nah an die damaligen ländlichen Siedlungen gebunden. Das hatte zur
Folge, dass die dadurch im Laufe vieler Jahre gebildeten sehr humus- und nährstoffreichen Plaggenesche heute unter Häusern und Straßen oder in der Nähe von Siedlungen liegen, wo wir tagtäglich mit Flächennutzungskonflikten und Versiegelung zu kämpfen haben. Diese Plaggenesche sind jedoch heute noch sehr wichtig für die Landwirtschaft. Bei der Ausweisung von Baugebieten wird aber leider nur nach der Fläche und insbesondere bei Gewerbegebieten nach Standortfaktoren wie Autobahnnähe gefragt, nicht nach den wertvollen Böden unter der Oberfläche. Hinzu kommt, dass wir in Zeiten des Klimawandels Böden, die sehr viel organischen Kohlenstoff enthalten und dadurch zusätzlich auch noch eine hohe Wasserspeicherfähigkeit aufweisen, sehr sorgsam behandeln und vor allem nicht versiegeln sollten. Klaus Mueller hat es in seinem Buch vorbildlich geschafft, ausgehend von der historischen Entwicklung der Kulturlandschaft und einer anschaulichen Vorstellung des Bodentyps Plaggenesch, die heutige Bedeutung dieser zu den „Kultosolen“ gehörenden Böden für die Menschen darzulegen.
Noch aus einem weiteren Grund ist dieses Buch auch für die Mitglieder des Europäischen Bodenbündnis informativ. Es ist hervorragend für die Bodenbewusstseinsbildung geeignet. Viele Menschen haben großes Interesse an der Landnutzungshistorie verbunden mit den Geschichten über die damaligen Bewohner, die in diesem Fall mit der „Plackerei“ ihren Lebensunterhalt sichern mussten. Daher ist der schutzwürdige Plaggenesch auch ein gutes Beispiel für die Archivfunktion des Bodens, die man den historisch interessierten Laien so ganz nebenbei vorstellen kann. Es lohnt sich im Übrigen auch, mal zu schauen, ob es in anderen Ländern in der Nähe ihrer Gemeinde Böden ähnlicher Nutzungsgeschichte mit Bodenabtrag und/oder Bodenauftrag gibt. In Osteuropa etwa sind Gebiete mit den Plaggeneschen ähnlichen Böden beschrieben. Um an aktuelle Diskussionen anzuknüpfen, kann man zudem im Gespräch mit interessierten Laien neuartige Formen der Anreicherung von Böden mit organischer Substanz und Nährstoffen z.B. durch Kompost mit der in Nordwestdeutschland verbreiteten historischen Variante vergleichen.
Prof. Dr. Gabriele Broll